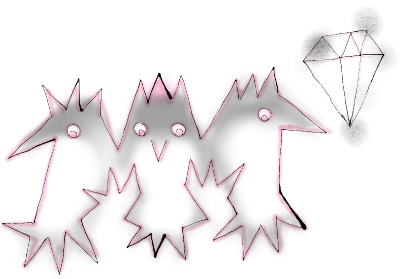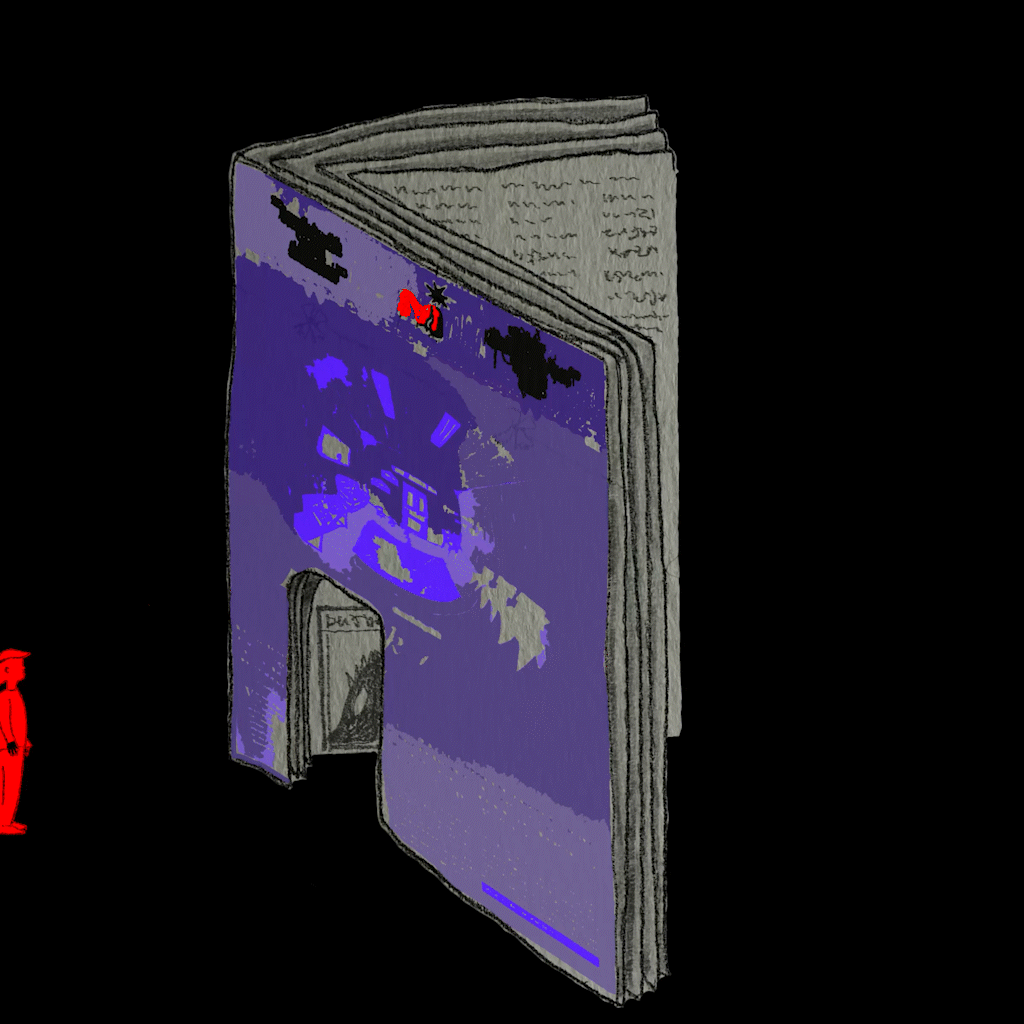Seit nun einem Jahr kehre ich immer wieder zum gleichen Album zurück: zum Debütalbum von Cameron Winter, der mich vom Cover aus mit grossen Augen anblickt. Seine Haare sind ähnlich wie meine. Er ist zwei Jahre jünger als ich, trägt ironische T-Shirts und wählt Memes als Titelbilder seiner öffentlichen Playlists, die gefüllt sind mit Legenden früherer Generationen: Nina Simone, Bob Dylan, Leonard Cohen. Bekannt wurde er als Frontmann seiner High-School-Band «Geese», deren Album «3D Country» ich vor zwei Jahren in Dauerschleife hörte. Es klingt, als wären Rock und Punk von einem wilden Pferd besessen und ich mochte es, abgeworfen zu werden und wieder aufzusteigen. Auf eine ebenso heissblütige EP liess die Band ein Cover von Justin Biebers «Baby» folgen. Ein Riesenbanger, der die Unvorhersehbarkeit unterstreicht, die auch ihr diesjähriges Album prägt. «Getting Killed» ist anders als «3D Country» und trotzdem eine logische Fortsetzung, die nur von dieser Band kommen kann. «Geese» spielt im März im X-TRA und die verbleibenden zwei Monate reichen längstens, um dich in die Band zu verlieben. Und in Cameron Winter. «Heavy Metal» heisst sein Soloalbum. Nach zwei Singles im Oktober erschien es letzten Dezember, ich hörte es im Januar zum ersten Mal. Mit keinem anderen Album habe ich seither so viel Zeit verbracht. So auch vor einigen Wochen im Zug durch Rumänien, als ich von Cluj nach Deva fuhr, um dort den Nachtzug zu erwischen. Die Landschaft ist karg, wunderschön und gespickt mit Schafherden, Hunderudeln und wilden Pferden. Ich habe kein Netz und geniesse, dass mein Handy mir nicht mehr bietet als das wiederholte Durchforsten meiner Fotogalerie und die wenigen Lieder, die ich für den Notfall heruntergeladen habe. Cameron Winters Stimme passt zum genähten Riss im Sitz gegenüber und zum Spalt in der Scheibe. Sie ist wie ein alter Mann mit einem wilden Leben, randvoll mit Geschichten, die Winter zu erzählen weiss. Er biegt sie, bis sie bricht, jagt sie Berge hoch und stösst sie herunter und wenn sie entgleist, kommt sie an den schönsten Orten zum Stehen. Er verrenkt sie, wie ein Schlangenmensch, um jeden Winkel meines Kopfs mit Emotionen zu füllen, die er mit seinen Instrumenten ausmalt. Die schleppenden, dissonanten Töne in «Try as I May» sind nicht weniger detailreich als die euphorisch scheppernden Klavierklänge auf «Nina + Field of Cops», nicht weniger komplex als das helle Geplänkel auf «Cancer of the Skull». Welten, in denen man sich verlieren will, die jedem Lied eigene Charakterzüge ansozialisieren. Cameron Winters Texte handeln von Liebe, Musik, seinem Schaffensprozess und der Unzulänglichkeit, die er alldem gegenüber empfindet. Es ist das Manifest eines Künstlers. Er singt von unerfüllten Erwartungen und der Entfremdung, die daraus resultiert, verpackt seine Gefühle in surreale Bilder und evokative Vergleiche, nur um sich sogleich entwaffnend schnörkellos zu geben. Am liebsten habe ich die Zeilen, die ich nicht ganz verstehe. Nach einer Dreiviertelstunde ist es vorbei, «Can’t Keep Anything» geht nahtlos in klappernde Zuggeräusche über. Es dämmert und ich sehe mich selbst in der Scheibe.