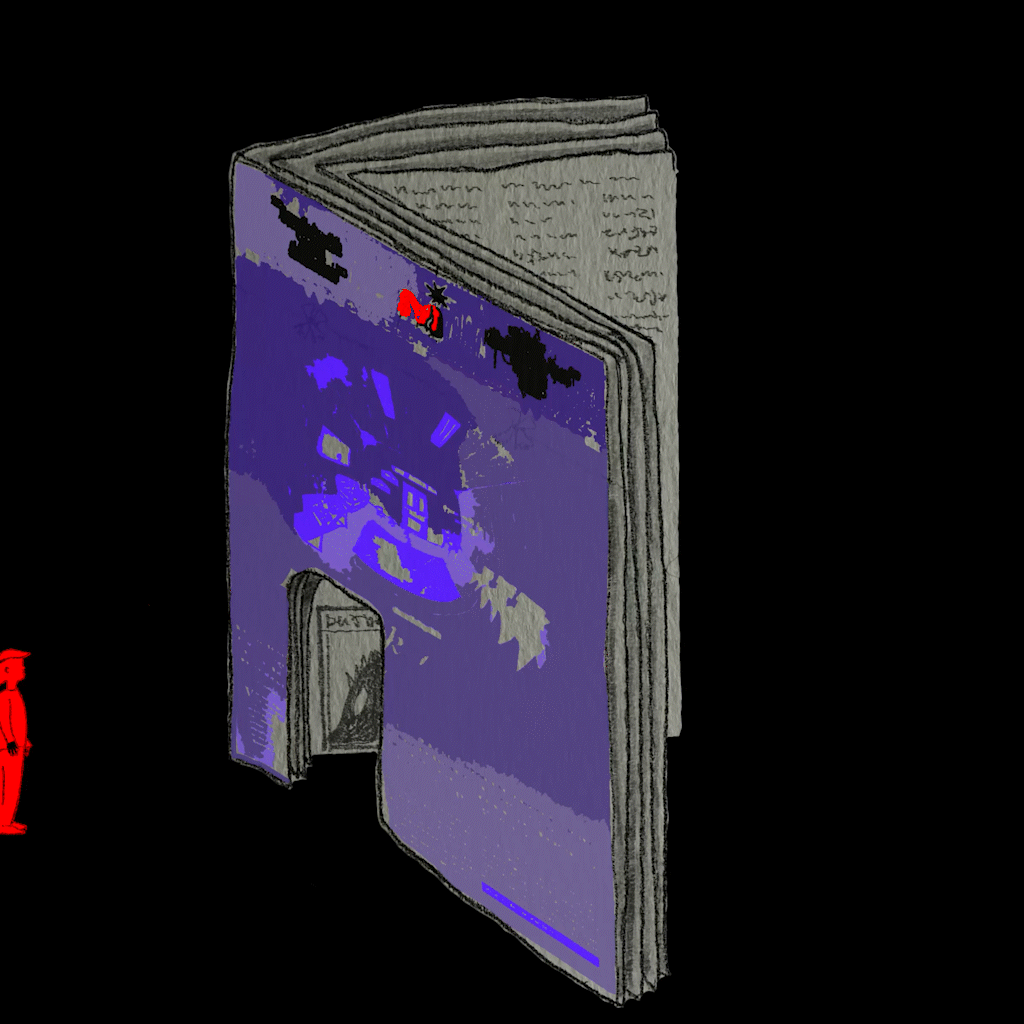Zwei Frauen geraten mit ihren Strategien immer wieder an ihre Grenzen. Über Umwege kommen sie beide an denselben Ursprung ihrer Probleme: Autismus. Eine neurologische Entwicklungsstörung, die in ihren Ausprägungen und Erscheinungsbildern viel facettenreicher ist als das Stereotyp des «sozial inkompetenten Nerds»
Nina (26) und Lucia (29) sind zwei Frauen, die durch ihre Art zu sein immer wieder an Grenzen gestossen sind. Nina geriet durch herausfordernde Situationen, wie plötzliche Planänderungen, auf die sie keinen Einfluss hatte, in dissoziative Zustände oder lag danach tagelang nur noch im Bett. Lucia ist in ihrem Alltag immer mal wieder mit einer inneren Wut konfrontiert; eine Reaktion auf ihre Ohnmacht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Wut flammt auf, wenn
sich ihr Gegenüber in einer Machtposition befindet, sei es bewusst oder unbewusst. Sie zeigt sich bei Lehrpersonen, Vorgesetzten, Freund*innen und bei ihr selbst, nimmt die Beziehungen in Beschlag und durchkreuzt auf diese Weise ihre Pläne.
In Einklang mit sich und der Welt fühlen sich beide in der Auseinandersetzung mit Kunst. Ninas Bedürfnis nach Ordnung und Präzision verlangt eine Verlangsamung und prägt dabei ihren Schaffensprozess, wie auch ihre Werke: Die Kamera in der Hand, sucht sie so lange, bis der Ausschnitt ihrem
Empfinden von Harmonie entspricht, sie im Bild ihre innere Welt gespiegelt sieht. Lucia ist Schneiderin und vertieft sich zurzeit in die Schmuckproduktion. Sie hat sich das Löten selbst beigebracht und kann sich tagelang in die Arbeit vertiefen. Sie formt Figuren zu Finger- und Ohrringen, die in kühlen Farben wild und leidenschaftlich wirken.
Autismus verstecken – Schulzeit bewältigen
Nina wuchs in einem Dorf auf, wo sie jeden Morgen mit dem Postauto zur Schule fuhr. Weil nur wenige Busse pro Stunde fuhren, war Nina klar, in welchen sie einsteigen musste. Und für den Buschauffeur war es in Ordnung, dass Nina jeweils vorne, neben ihm sass. In der Schule sammelten sich die wenigen Kinder der Umgebung in jahrgangsübergreifenden Klassen. Durch die altersbedingt unterschiedlichen Bedürfnisse war es für die Lehrpersonen normal, auf alle Schüler*innen einzeln einzugehen. Schulisch hatte Nina wenig bis keine Mühe und erzielte ohne Aufwand gute Noten. Die dadurch eingesparte Energie steckte Nina unbemerkt in Strategien, die ihr halfen, alltäglichen Stress zu umgehen. Da (in ihrer Wahrnehmung) unästhetische Dinge negative Reaktionen in ihr hervorrufen, hat sie früh gelernt, damit umzugehen: Arbeitsblätter, die ihr nicht gefielen, klebte sie nur an den Ecken in ihr Heft, um sie zu Hause leicht wieder lösen zu können. In der Zeit, in der andere den Schulstoff lernten, schrieb sie die Inhalte der Arbeitsblätter schliesslich ab und gestaltete die Heftseiten nach
ihrem ästhetischen Empfinden.
Lucia ist ebenfalls auf dem Land aufgewachsen und dort bis Ende der obligatorischen Schulzeit, wie sie sagt, einigermassen gut zurechtgekommen. Mit dem Wechsel ins Gymnasium kam der Wechsel in die Stadt, den sie als grosse Herausforderung beschreibt. Die Stadt konfrontierte sie mit neuen «Social Cues» (Kommunikation über Mimik, Körpersprache, Tonfall und physischen Raum/Grenzen) die sie nicht verstand. Das hatte zur Folge, dass sie Fassaden und Absichten von Gegenübern nicht lesen und bei gewissen Gesprächsthemen nicht mithalten konnte. Besonders litt sie unter Gruppendynamiken, Machthierarchien, Leistungsdruck und Vergleichen mit anderen. In dieser Zeit war sie im Austausch mit ihrer (ebenfalls autistischen) Cousine, die sich in derselben Situation befand, wie Lucia. Sie halfen sich gegenseitig, die Social Cues zu analysieren und einzuordnen. Zusätzlich zu den Prüfungen lernten sie also auch all die individuellen Sprachen ihres Umfelds und ihrer Lehrpersonen.
Anpassungsleistungen und ihre Folgen
Die Welt, in der Nina aufgewachsen ist, hat ihren Bedürfnissen entsprochen: Ein reizarmes Landleben, eine vorgegebene Struktur durch die ÖV-Verbindungen, kleine Klassen und Lehrpersonen, die es gewohnt waren, den Unterricht zu individualisieren. Laut ihren Zeugnisberichten waren Regeln und deren Einhaltung (von allen Beteiligten) wichtig für Nina. Mit der Trennung ihrer Eltern und dem Beginn der Pubertät geriet ihre strukturierte Welt ins Wanken. Der Kontrollverlust beeinflusste ihr Sicherheitsempfinden in sozialen Situationen. So verstärkte sich ihre Schwierigkeit, unter Leuten zu essen, enorm. Sie begann sich zurückzuziehen und entwickelte eine Depression. Die Energie, die Nina benötigt, um solche Ereignisse zu verarbeiten, unterscheidet sich erheblich von der Energie, die neurotypische Personen in vergleichbaren Situationen aufwenden müssen. Im Gymnasium hat sie aus diesen Gründen ein Quartal pausiert. Das Fotografie-Studium musste sie abbrechen. Nun hat sie ein Studium in Prozessgestaltung an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel abgeschlossen, bei dem sie Einfluss auf die Struktur und Intensität der Präsenzzeit nehmen konnte.
Trotz der regelmässigen Austausche mit ihrer Cousine, kam Lucia immer wieder in Situationen, in denen es ihr nicht gelang, soziale Situationen für sich zu übersetzen und sich der neurotypischen Sprache anzupassen. Dabei erkennt sie auf beiden Seiten Kommunikationsschwierigkeiten: Bei ihr lösen unausgesprochene Erwartungshaltungen und Dinge, die Menschen sagen, aber nicht so meinen, Irritation aus. Ihr Verhalten werde im Umkehrschluss häufig fehlinterpretiert: Ohne dies zu beabsichtigen, werde sie oft als unfreundlich oder provokativ wahrgenommen. Nach der Wiederholung solcher Erfahrungen, entstand bei ihr der Eindruck, nicht wirklich wahrgenommen zu werden. Sie fühlte sich zunehmend isoliert und einsam.
Die Entdeckung bringt Erleichterung
Mit 25 Jahren wurde bei Nina nach Abklärungen für Epilepsie, das chronische Fatigue-Syndrom und weitere Krankheiten schliesslich Autismus festge- stellt. Seither befindet sie sich in einer intensiven Auseinandersetzung mit der neurologischen Entwicklungsstörung. Die Entdeckung hilft ihr dabei, sich besser einzuordnen und sich so anzunehmen, wie sie ist. Es fällt ihr seither einfacher, ihrem Umfeld zu erklären, wie sie die Welt um sich herum wahrnimmt. Oder nachzufragen, wenn sie Witze, Ironie oder andere Implikationen nicht versteht. Sie ist ausserdem weniger streng mit sich und konnte die Schuldgefühle überwinden, die sie davon abhielten, sich bei der IV anzumelden.
Unterstützung erhofft Nina sich von der IV nicht primär auf finanzieller Ebene. Viel eher erhofft sie sich die Möglichkeit, eine Ausbildung Teilzeit absolvieren zu können. Denn eine Vollzeitausbildung war für sie bisher nicht möglich – das auf neurotypische Schüler*innen ausgerichtete Schulsystem forderte ein Ausmass an Anpassungsleistungen, die ihren täglichen Stress eine auf Dauer nicht bewältigbare Dimension annehmen liess. Und das trotz ihrer schnellen Auffassungsgabe und Fähigkeit zur Selbstorganisation: In der Schule schrieb
sie stets gute Noten, ausserdem absolvierte sie ein Gymnasium, das zu einem Grossteil auf selbstorganisiertem Lernen basierte.
Lucia liess sich mit 29 Jahren auf Autismus abklären. Zu diesem Zeitpunkt wurde bei ihr bereits AD(H)S diagnostiziert, was jedoch nur einen Teil ihrer Fragezeichen auflöste. Wie Nina fällt es Lucia seit der Entdeckung ihres Autismus leichter, sich selbst zu akzeptieren. Und auch ihr Umfeld reagiert mit mehr Verständnis: Durch die Auseinandersetzung mit Autismus und AD(H)S fällt es ihnen einfacher, Lucias tägliche Herausforderungen zu erkennen und die Leiden, die diese mit sich
bringen, zu verstehen. Neben all den positiven Auswirkungen wird Lucia auch mit Stigmatisierung konfrontiert, die sich ihrer Ansicht nach nicht so einfach aus der Welt räumen lässt. Denn Stigmatisierung erlebt sie auch von Menschen, die sich
selbst als offen und inklusiv einschätzen.
Die häufige Vermutung von Personen, die realisieren, dass Neurodiversität aus Merkmalen besteht, die alle Menschen kennen, und die dann daraus schliessen, dass wir alle etwas autistisch seien, vergleicht Nina mit einer Schwangerschaft: Niemand kommt nach der wiederholten Beobachtung des gemeinsamen Auftretens von Übel- und Müdigkeit auf die Idee, zu behaupten, wir wären alle etwas schwanger!