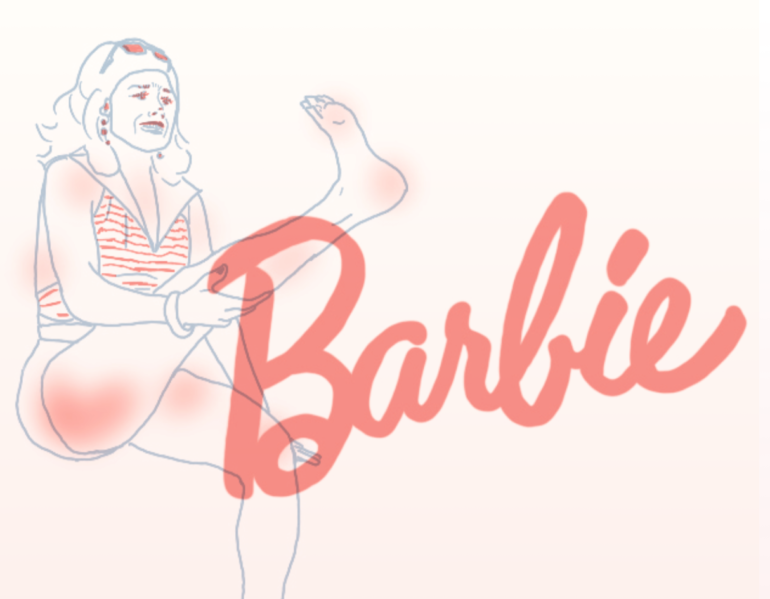
Und plötzlich musste Barbie an diesem lauschigen Sommerabend an den Tod denken. Das allererste Mal. Und das allererste Mal ist auch Barbie’s Toast verbrannt, die Milch abgelaufen und ihre Füsse sind flacher als sonst. Das wirft Barbie gewaltig aus der Bahn. Dermassen fest, dass Barbie in die richtige Welt reist. Sie lebt nämlich in einer Art Parallelwelt, «Barbieworld», in der die politische Organisationsform des Matriarchats herrscht. Entgegen der Erwartung zeigt sich die reale Welt verstörend: Männer und Pferde regieren das, was Patriarchat genannt wird. Barbie, enttäuscht, weiss nicht mehr, wer sie ist. Ken, der Barbie begleitet, wird nun mit allen Rollen, die das Patriarchat ihm ermöglicht, konfrontiert und weiss endlich, was er sein soll: ein echter Mann. Plötzlich glaubt er, mehr als nur «Beach» zu können (das ist nämlich seine Aufgabe im Barbieland: Am Beach sein und darauf warten, dass er von Barbie beachtet wird). Einfach, weil er ein Mann ist. Das prägt den Ken dann schon fest, weshalb er nun das Barbieland brainwashen will, was ihm auch gelingt. Alle Barbie’s tanzen nach seinem Sixpack und seiner platinblonden Mähne. Durch feministische Reden schaffen es die Barbies, sich zu ent-brainwashen und ihre Spitzenpositionen zurückzuerobern. Kendom zerbricht allmählich und das Mojo Dojo Casa House, so hat Ken das Barbiehaus umbenannt, bietet den Kens nicht länger ein sicheres Feld zum «Mann sein». Die Sinneskrise folgt. Wo sie noch am Lagerfeuer so friedlich sangen: «I wanna push you around, well I will, well I will», schmelzen nun sämtliche konstruierten Rollen ins Nichts. Barbie hingegen will mehr. Sie wird zu einem echten Menschen. Denn Barbie kann alles.
Es entstand ein weltweiter Mangel an pinker Farbe.
«She’s everything, he’s just Ken». So auch der Slogan auf dem pinken Plakat im Cine Club am Samstagnachmittag. Der Barbie-Film scheint ja schon ein echter Hype zu sein. Die Propaganda bewirkt, was sie bewirken soll. Da springen doch von rechts bis links und in Bern mehrheitlich ganz links alle in die Sääle, bestenfalls mit einem pinken T-Shirt oder Jüpli ausgestattet und fresen sich diesen Sommer Blockbuster mit angekündigtem Tiefgang rein. Der Sitz ist bequem, die Erwartungen gross. Da würde mensch sich gewaltig was entgehen lassen, diesen fortschrittlichen Kapitalismus-Klotz der laut Social-Media bahnbrechend sein muss, nicht anzuschauen. Und auch wenn du es nicht glaubst: Der Film wurde von Mattel seinerseits (dem Barbie Hersteller höchstpersönlich) produziert. Was kann da mehr zu erwarten sein, als eine fette Ladung Selbstironie? Schleichwerbung und Heteronormativität, obviously. Die Regisseurin Greta Gerwig (Ladybird, Little Women), wagt sich mit Margot Robbie (Barbie) und Ryan Gosling (Ken) als Hauptfiguren quite a lot. Das Projekt immenser Grösse wurde laut verschiedenen Quellen mit einem Budget von 145 Millionen produziert und sei laut Mattel nur eine von vielen weiteren Spielzeug-Verfilmungen, die in den kommenden Jahren erwartet werden dürfen. Da wurde also auch bezüglich Grosskampagnen (Zara, Primark etc.), Influencer*innen-Promotion und Werbe-Events nicht eingespart. Es wird sich wohl nadisna seltener einen barbielosen Haushalt finden lassen. Insbesondere nach dieser Vermarktung.
White Feminism at it’s finest.
Und da tut es mich halt schon wundern, warum in den ersten Minuten des Streifens ganz selbstironisch eine angenehme Stimme durch den Saal säuselt, die Barbie habe schliesslich jedes Problem der Frauen aus der Welt geschaffen und den Feminismus geradezu begründet. Barbie wird zu einer Identifikationsfigur (zumindest weisser, schöner, gutverdienender Frauen), nun auch für Erwachsene. Also es wundert mich deshalb, weil der Film ein vermeintlich kritisches Selbstbild abgibt, dabei gefeiert wird feministische Kritik zu üben und aber im Grunde genommen lediglich Eigenwerbung für ein an sich problematisches Kinderspielzeug betreibt. Nur eben dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene darauf hereinfallen. She’s everything: Barbie kann alles sein, was sie will. Präsidentin, Gärtnerin, Nobelpreisträgerin, Ärztin oder Musikerin. Die Barbie zeigt sich wirklich glücklich und unabhängig. Dies ändert sich zwar, sobald sie mit den unangenehmen menschlichen Gefühlen und Überforderungen zu kämpfen hat. Aber das ist ganz normal und auch wunderschön. Denn das macht das Menschsein aus, predigt die Steuerhinterzieherin Ruth Handler (Gründerin Mattel’s). Passend zur predigt prasseln alltägliche Aufnahmen von Müttern und Kindern über den Bildschirm, unterstützt von aufwühlender Musik.
Welche Message wird hier eigentlich verbreitet?
Das drückt richtig auf die Tränendrüsen. Auch bei mir. Und so schafft es Barbie, mich fast zu berühren. Wahrhaftig. Denn Billie Eilish, die einen Song zum Film geschrieben hat, kaufe ich jedes Gefühl ab. Und Barbie und ich fragen uns auf und vor der Leinwand: What was I made for? Das ist almost too deep. Aber nicht gut genug für mein aufgebrachtes Emanzen-Herz. Und als Margot Robbie von der Off-Stimme abgesprochen wird, sich hässlich zu fühlen, breche ich mit jeglichen Bewunderungen. Doch das Publikum lacht, fühlt sich mit dieser aufmerksamen Geste gesehen, scheint die Haltung Mattel’s zu teilen: Margot Robbie ist viel zu hübsch, repräsentiert zu fest das gängige Schönheitsideal, als dass sie sich dafür hässlich fühlen dürfte. Ich bin irritiert, fast wütend. Das ist nicht die Art von Body-Positivity, die ich mir ersehne. Die würde nämlich ein Verständnis für alle Körper und Struggles, welche Menschen damit haben, voraussetzen. Denn auch eine vermeintlich makellose Margot Robbie wird ihre Unsicherheiten haben. Diese auf grosser Leinwand zu invalidieren sehe ich als problematisch. Und ja: Das wurde ja schon ganz gut gemacht, diese Verarbeitung eines Befreiungsaktes von Frauen aus Ungleichheit, Unterdrückung, Sexualisierung, Benachteiligung und Schönheitsidealen – alles im Mainstream eingebettet. Doch das geht einfach…zu wenig weit. Ich sehe, dass es an der Zeit ist, solche Themen an das breite Publikum zu bringen und dass es anhand eines weltweiten Kommerz-Produktes, der Barbie, ganz gut funktioniert.
Alle fahren drauf ab. Und ich reite drauf rum.
Das hat dieser Mattel gut gemacht mit diesem Film. Ja wirklich. Bravo. Schachmatt, dieser kapitalistische Zug füllt die Kassen. Das klingelt im Sparsöili, aber pinkiger kanns nicht mehr werden. Höchstens eine gemästete Sau, denn was Mattel mit diesem Film hauptsächlich macht ist Geld. Die Kapitalismuskritik hält sich in Grenzen. Und das tut mich dann schon – ehrlich gesagt – enttäuschen. Enttäuscht ist wahrscheinlich auch der Typ, welcher diesen schlimmen Männerhass im Film nicht verstehen kann. Seine Kenergy sprengt meinen Handybildschirm und ich finde es recht entertaining. Denn das wird während dem Popcornessen klar: Männer sind das Problem hinter den Folgen des Barbie-Kults. Der Film ist eine harte Kritik am Patriarchat, dessen Strukturen und nicht zuletzt auch ganz offensichtlich an den Männern selbst. Ken ist eine leere, dümmliche Hülle, erhält erst durch patriarchale Vorbilder so etwas wie Identität und leidet offensichtlich auch selbst darunter. Auch bezüglich Diversität versucht «Barbie» repräsentativ zu sein. Dies anhand von einer schauspielenden Person im Rollstuhl, einer Dicken, einer handvoll BIPOC Personen und einer trans-Person. Alle besetzen Nebenrollen. Zu wenig überzeugend um der Zerlegung von westlichen, weissen Schönheitsidealen ernsthaft gerecht zu werden. Doch letztlich halt eine wahrhaftige Repräsentation dessen, was Mattel in den letzten Jahren an Diversität auf den Markt gebracht hat. Dementsprechend realitätsgetreu. Wenn die kritische Auseinandersetzung mit Schönheitsidealen sich auf ein 4 Quadratzentimeter grosses Stück Cellulite am Oberschenkel von Margot Robbie reduziert, versinke ich im samtenen Kinostuhl und schäme mich für die 20 Franken, die ich Mattel in die pinke Sparsau getan habe. Aber ich gehe gerne ins Kino und sowohl die Musik als auch die Verfolgungsjagd schneller Autos mit spannenden Videoaufnahmen gefallen mir gut. Ein zwei Witze bringen mich recht fest zum Lachen. «You can Ken» oder als er dann zwei Sonnenbrillen übereinander anzieht. Das ist schon recht lustig. Und auch die eine oder andere kritische Aussage kommt mir in den richtigen Hals. Viele Ansätze des Barbie-Films geben Einblick in eine kritische Hinterfragung der gängigen Gesellschaft und versuchen Stereotypen zu dekonstruieren. Dies gelingt jedoch nur auf niederschwelligen Ebenen. Bahnbrechende Erkenntnisse lassen sich nicht ziehen. Die Story erinnert an einen Kinderfilm mit wenig Spannung und scheint definitiv nicht Priorität der Produktion gewesen zu sein. Sie hinterlässt das Publikum fragend. Der Spagat zwischen Kommerz-Komödie und feministischer Patriarchats-Kritik ist Gerwig nicht annähernd so gut gelungen wie der weirden Barbie, einer Barbie mit kurzen Vokuhila-mässigen Haaren, farbigen Kleidern und ausgefallenem Verhalten und by the way der einzigen Figur im Film, die als potenziell queer gelesen werden könnte. Und das ist ja schon recht weird: das Ganze mit dem queer-coding. Queer-coding meint, wenn durch das Verhalten, Sprechen oder anderen subtilen Verhaltensformen die unausgesprochene Queerness von Charakteren impliziert wird.
Was ich dir stattdessen raten würde.
Da geht einfach einiges nicht auf mit diesem Barbie-Film. Deshalb empfehle ich denen, die gerne lieber 20 Franken mehr (35 mit Cola und Popcorn) in ihrem eigenen Sparsöili haben wollen, lieber zuhause vor dem ins Bett gehen das Lied von Billie Eilish: «What was I made for?» mit Kopfhörern auf voller Lautstärke anzuhören. Das gefällt. 🙂
PS: das Musikvideo ist auch recht gut.
